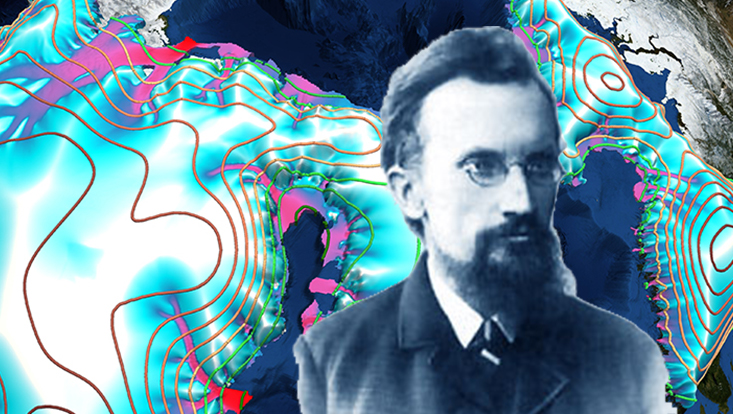Großprojekt startetWenn Permafrost rapide tautInternationale Forschung in der Arktis: ESRAH-Team mit Modellierungs- und Biogeochemie-Expertise dabei
8. Oktober 2025, von AWI und ESRAH

Foto: Christian Knoblauch/ UHH
Abrupt auftauender Permafrost kann den Klimawandel zusätzlich beschleunigen. Forschende wollen herausfinden, wie stark die dadurch entweichenden Treibhausgase Kohlenstoffdioxid und Methan das Klima beeinflussen. Im internationalen Projekt Rapid Permafrost Thaw Carbon Trajectories (kurz: PeTCaT) unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts ist neben Partnern aus den USA, Kanada, den Niederlanden und Schweden auch der Fachbereich Erdsystemwissenschaften als Teil des Earth and Society Research Hub (ESRAH) der Universtität Hamburg beteiligt. Rund 1,8 Millionen Euro der Fördersumme entfallen auf die Universität.
Besonders relevant sind abrupte Tauprozesse, bei denen innerhalb weniger Jahre ganze Abschnitte von Permafrost-beeinflussten Ökosystemen verschwinden, etwa wenn Küsten abbrechen, sich sogenannte Thermokarstseen vertiefen oder Hänge abrutschen und eisreichen Boden freilegen. Dabei werden große Mengen an organischer Substanz freigesetzt, die Jahrhunderte bis Jahrtausende gefroren waren, und die nun von Mikroorganismen in CO₂ und Methan umgewandelt werden. Diese abrupten Prozesse sind bisher wenig erforscht und werden in Klimamodellen nicht berücksichtigt. Die weitverbreiteten schnellen Tauvorgänge und ihre Folgen beeinflussen den Kohlenstoffkreislauf, besonders über die kurzen Zeiträume von Jahren und wenigen Jahrzehnten, die für die Klimapolitik relevant sind.
„Um die Treibhausgasbilanz der Arktis besser einschätzen zu können, müssen wir verstehen, wie biogeochemische Prozesse im Boden und die Vegetation beim abrupten Tauen des Permafrosts zusammenwirken“, sagt Christian Beer, einer der beteiligten ESRAH-Forschenden vom Institut für Bodenkunde der Universität Hamburg. „Dazu führen wir hier neue Felduntersuchungen und Laborexperimente durch.“

Projektleiter Guido Grosse vom AWI ergänzt: „Wie schnell Permafrost auftaut, hängt stark von der Region und den dortigen Prozessen ab.“ Abrupte Prozesse seien bisher kaum erforscht. Permafrost in der Arktis speichert große Mengen an organischem Kohlenstoff in gefrorenen Böden, etwa in Form zersetzter Pflanzen. Doch die Arktis erwärmt sich schnell und lässt diese Speicher auftauen. Die Folge: Immer mehr Treibhausgase aus den Böden gelangen in die Atmosphäre.
Die Forschenden schaffen nun einen neuartigen Datensatz: Zunächst nutzen sie Fernerkundung und Deep-Learning-Methoden, um die abrupten Tauprozesse in der gesamten Arktis zu kartieren. So wollen sie herausfinden, wo, wie häufig und wie stark diese Prozesse ablaufen – und wie sie mit Klimaveränderungen und Extremereignissen zusammenhängen. Diese Informationen verknüpfen sie mit bestehenden Datensätzen und Modellen, um abzubilden, wie sich solche Veränderungen künftig entwickeln könnten.
Gleichzeitig sammelt das Team Daten an ausgewählten Standorten in der Arktis. Die Forschenden nehmen Bodenproben und messen die Flüsse von Treibhausgasen, um herauszufinden, wie schnell verschiedene Arten von organischem Material aus auftauendem Permafrost abgebaut werden.
„Ein Puzzlestein besteht darin, dass wir die gewonnenen Ergebnisse standardmäßig in unsere Rechenmodelle mit einbauen“, erklärt Chrisitan Beer. „So können wir die Folgen von abruptem Tauen in Simulationen einbeziehen – und damit auch abschätzen, was sie für das verbleibende globale Kohlenstoffbudget und die Klimaziele bedeuten.
Dazu entwickelt das Projektteam in den kommenden fünf Jahren verschiedene Klimaprojektionen, die zeigen, wie sich der Kohlenstoffkreislauf und das Klima im arktischen Permafrostgebiet künftig entwickeln könnten. Die Projektionen bilden dabei auch ab, welche Wechselwirkungen mit veränderten Vegetationsmustern und biogeochemische Rückkopplungen diese zusätzlichen Emissionen in verschiedenen Klimaszenarien auslösen können.
Über PeTCaT
Das Forschungsprojekt läuft von Oktober 2025 bis September 2030. Es wird mit rund 8,8 Millionen Euro von der gemeinnützigen Organisation Schmidt Sciences gefördert. Der geografische Schwerpunkt liegt auf der gesamten Arktis, mit Feldstudien in Alaska, Kanada und Finnland. Unter Leitung des Alfred-Wegener-Instituts (AWI) arbeiten in PeTCaT mehrere internationale Institutionen zusammen: das AWI (Deutschland), die University of Alaska Fairbanks (USA), die University of Alberta (Kanada), die Universität Hamburg (Deutschland), die Stockholm University (Schweden) und die Vrije Universiteit Amsterdam (Niederlande).